
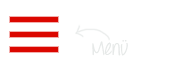
Neue Züchtungsmethoden
Die Trilog-Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedsländern, der EU-Kommission und dem EU-Parlament sind beendet und sehen Deregulierungen beim Einsatz neuer Züchtungsmethoden (Neue Genomische Techniken, NGT) vor. Nun sind das EU-Parlament und der Rat am Zug.
Saatgut Austria begrüßt die geplanten Erleichterungen grundsätzlich und „sieht darin einen ersten wichtigen Schritt für die Erhaltung einer hohen Innovationskraft in der Pflanzenzüchtung“. Dazu Rainer Frank, Obmann von Saatgut Austria: „Die Landwirtschaft von morgen ist auf die stete Weiterentwicklung von Sorten und Innovationen aus der Pflanzenzüchtung angewiesen. Moderne Züchtungsmethoden leisten einen wichtigen Beitrag, um aktuellen Herausforderungen wie steigenden Bevölkerungszahlen, sinkenden Anbauflächen und Auswirkungen des Klimawandels gerecht zu werden und einige Züchtungsziele schneller zu erreichen. Für Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken wie CRISPR/Cas hergestellt wurden und kein artfremdes Genmaterial enthalten, sind daher vereinfachte Zulassungsverfahren geplant. Das ist ein positives Signal für die Saatgutwirtschaft und Pflanzenzüchtung.“
Damit gibt es keine Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von NGT1-Produkten. Zudem entfallen Auflagen wie die Kennzeichnung der Ernteprodukte. Auch für die Biolandwirtschaft wurde eine praktikable Lösung gefunden, indem ein „technisch unvermeidbares Vorhandensein“ erlaubt wird. Allerdings wurden zahlreiche zusätzliche Elemente in den Text aufgenommen, die eine sorgfältige Analyse der möglichen Auswirkungen erfordern.
Saatgut Austria sieht auch die Ankündigung der EU-Kommission positiv, gemeinsam mit unterschiedlichen Interessengruppen einen konstruktiven Dialog zu Sorten- und Patentschutz sowie zum Züchterprivileg zu starten, um eine höchstmögliche Rechtssicherheit und Informationstransparenz für Züchter und Landwirte zu gewährleisten.

SAATGUT AUSTRIA
Wiener Straße 64, A-3100 St. Pölten
Tel.:+43(0)50 259 22500
office@saatgut-austria.at
